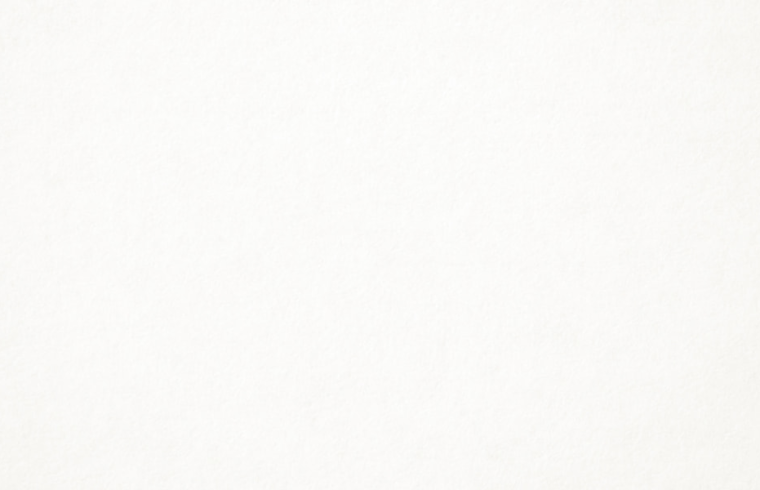70 Jahre Bundesrepublik, 30 Jahre Mauerfall: ZEIT ONLINE widmet diesen Jubiläen die Serie “Deutschland 70/30”. Die Geschichte der BRD begann mit dem Grundgesetz. Wie heftig darum gestritten wurde, ist heute fast vergessen.
61 Männer, vier Frauen. Sie waren es, die in den Jahren 1948 bis 1949 entscheiden mussten, nach welcher Grundordnung Westdeutschland nach dem verlorenen Krieg und der Teilungweiterleben sollte. Eine Verfassung sollte es werden, ordneten die alliierten Siegermächte an. Ohne die keine Souveränität. Doch die Mitglieder des Parlamentarischen Rates – die Väter und Mütter des Grundgesetzes – sträubten sich nicht nur dagegen, sie waren sich auch nicht einig, was drinstehen sollte. Die Rechtsordnung, nach der wir heute in West wie Ost leben, war 1949 in vielen Punkten also nicht selbstverständlich. Vier animierte Grafiken zeigen Grundgesetzartikel in ihrer
heutigen Fassung – und Alternativen, die damals debattiert wurden.
Volksabstimmungen
Wer wollte sie?
Verschiedene Gruppen in der Nachkriegszeit wollten weiterhin, dass das Volk direkt über politische Maßnahmen abstimmen kann – und sie wollten das auch im Grundgesetz festschreiben. Schließlich gab es dafür damals mehrere Vorbilder: Die Weimarer Reichsverfassung hatte direktdemokratische Elemente vorgesehen, genau wie einige Landesverfassungen nach 1945.
Der SPD waren solche Plebiszite, also Volksentscheide, wichtig. Manche Sozialdemokraten waren dabei von ihrer Zeit im Schweizer Exil inspiriert. Carlo Schmid, der Vordenker der SPD jener Zeit, betonte: “Wir wollen kein Monopol für die repräsentative Demokratie.”
Dass die SPD später von ihrer Meinung abrückte, lag auch daran, dass sie sich nicht gemeinmachen wollte mit den anderen, die ebenfalls mehr Macht fürs Volk forderten. Zum einen waren das die Kommunisten: Die KPD agitierte im Parlamentarischen Rat so wüst, dass kein anderer mit ihr etwas zu tun haben wollte.
Neben der KPD warb noch die katholische Zentrumspartei für die Plebiszite. Anders motiviert, aber ebenfalls energisch, kämpfte ihre Vertreterin Helene Wessel für dieses “demokratisch selbstverständliche Recht”. Sie sah darin auch eine Chance, die politischen Einflussmöglichkeiten der katholischen Kirche zu wahren. Diese fühlte sich nämlich bedroht durch die CDU, dieser erfolgreichen überkonfessionellen Parteineugründung. Auch Wessels Anträge fanden keine Mehrheit.
Wer hat’s verhindert?
Volksentscheide seien eine “Prämie für Demagogen”, sagte damals der spätere Bundespräsident Theodor Heuss. Diese Haltung war typisch für die Nachkriegspolitiker, besonders für die bürgerlichen. Eine große Mehrheit im Parlamentarischen Rat traute den Deutschen eine direkte Demokratie nicht zu. Darin stimmten sie mit den Alliierten überein: Ein Volk, das eben noch den Nazis zugejubelt hatte, sollte möglichst nicht regelmäßig über emotionalisierte Sachfragen abstimmen.
Sorgen machten ihnen aber nicht nur rechte Demagogen, sondern auch andere mächtige Meinungsmacher wie die katholische Kirche oder die Gewerkschaften. Die Parteien wollten diese Organisationen möglichst von den politischen Entscheidungen fernhalten, ihnen zumindest nicht mit Volksabstimmungen ein Mittel zur Einflussnahme geben.
Was hätte das verändert?
Der Verzicht auf Plebiszite im Grundgesetz sei ein “Erfolgsgeheimnis” der Bundesrepublik, sagt etwa der Staatsrechtler Josef Isensee. Viele richtungsweisende Entscheidungen seien gegen die Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung durchgesetzt worden. Adenauers Westintegration, Brandts Ostpolitik, der Nato-Doppelbeschluss, die EU-Politik, die Agenda 2010 – all das wäre vermutlich anders verlaufen, hätte man die Deutschen darüber abstimmen lassen. Es war eine Politik gegen die Mehrheit, die aber im Nachhinein oft akzeptiert und gefeiert wurde.
Kritikerinnen und Kritiker verweisen hingegen darauf, dass das repräsentative System den starren, intransparenten Parteienstaat westdeutscher Prägung befördert hat. Volksentscheide hätten zu mehr Dynamik und einer stärkeren Identifikation der Menschen mit der Politik führen können. Womöglich hätte sich dadurch auch hierzulande ein anderes Demokratieverständnis entwickelt. Eines, das geprägt gewesen wäre von einem allgemein höheren Sachverstand und größerer Akzeptanz – wie in der Schweiz, wo sich in der Bevölkerung das Selbstverständnis herausgebildet hat, der wichtigste Kontrolleur der Regierung zu sein.
Übrigens: Völlig ausgeschlossen sind plebiszitäre Elemente laut dem heute geltenden Grundgesetz nicht. Der Antrag des CDU-Politikers Heinrich von Brentano, auch die “Abstimmungen” im Artikel 20 streichen zu lassen, fand im Parlamentarischen Rat keine Mehrheit. Ob und inwiefern es in der Bundesrepublik Volksentscheide geben darf, ist also Auslegungssache, die das Bundesverfassungsgericht und die Parteien immer mal wieder beschäftigt.
Gleichberechtigung
Wer wollte das?
Fast alle waren damals dafür, Männern und Frauen gleiche Rechte einzuräumen. So hatte es auch schon in der Weimarer Reichsverfassung gestanden. In den Augen der meisten im Parlamentarischen Rat gab es hier keinen Reformbedarf. Deutschland hatte bereits 1919 das Frauenwahlrecht eingeführt, man wähnte sich diesbezüglich recht fortschrittlich.
Allerdings war mit der Formulierung “dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten” keine vollständige gesellschaftliche Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gemeint. Diese Formulierung lehnten die meisten Mitglieder des Parlamentarischen Rates ab. Sie befürchteten, dass dadurch ein Rechtschaos ausbrechen würde. Denn schließlich galt bislang im Ehe- und Familienrecht das Bürgerliche Gesetzbuch aus dem Jahr 1900. Das würde damit schlagartig verfassungswidrig, warnte der spätere FDP-Vorsitzende Thomas Dehler.
Diesem Gesetz zufolge bestimmte im Zweifel der Ehemann, ob eine Frau arbeiten durfte, wie die Kinder erzogen wurden und noch vieles mehr. Verheiratete Frauen hatten die sogenannte Folgepflicht. Ihre Rechte beschränkten sich auf ihre persönlichen Angelegenheiten als Staatsbürgerinnen.
Der Diskriminierung von Frauen sollte dieser Passus vorbeugen: “Niemand darf wegen seines Geschlechtes (…) benachteiligt oder bevorzugt werden.” An der geltenden Rechtslage wollten die meisten der Verfasser des Grundgesetzes nichts ändern.
Wer war dagegen?
Sie hatten allerdings ihre Rechnung ohne Elisabeth Selbert gemacht. Die hessische Sozialdemokratin war eine der vier Frauen im Parlamentarischen Rat. Sie hatte den Antrag auf vollständige Gleichberechtigung eingebracht. Anfangs belächelten sie selbst ihre Parteifreunde. Selberts Forderung schien ihnen eine radikalfeministische Position. Sie entsprach keinesfalls dem SPD-Mainstream.
Aber die Genossen änderten ihre Meinung, als sie sahen, welche Protestwelle Selberts Forderung damals auslöste. Frauenverbände und Gewerkschafterinnen unterstützen sie mit Petitionen und Briefen. Mehrere Medien griffen die Forderung auf. Bald schloss sich die SPD ihrer eben noch isolierten Vorkämpferin an, etwas später auch die anderen Parteien. Am Ende stimmte der Parlamentarische Rat einstimmig für Selberts Formulierung. Den anfänglichen Widerstand versuchte mancher hinterher jovial als bloßes Missverständnis kleinzureden.
Was, wäre es beim alten Passus geblieben?
Ohne Selberts Initiative hätte sich an der rechtlichen Vormachtstellung des Mannes innerhalb der Familie so bald nichts geändert. Der Ehemann hätte das Entscheidungsrecht in allen Fragen des gemeinsamen Lebens beibehalten. Er hätte weiterhin über das Vermögen und die Arbeitsstelle der Frau bestimmen dürfen.
Auch wäre manche gesellschaftliche Debatte vermutlich anders gelaufen, hätten sich die Kämpferinnen für mehr Emanzipation nicht immer wieder auf das Grundgesetz berufen können. Schon so fiel es dem Gesetzgeber schwer, den Auftrag des Grundgesetzes umzusetzen. Die Übergangsfrist, auf die man sich 1949 verständigt hatte, um die übrigen Gesetze auf die neue Grundordnung anzupassen, verstrich 1953, ohne dass viel passiert war. Das Gleichberechtigungsgesetz trat erst fünf Jahre später in Kraft. Nun durften Ehemänner nicht mehr allein über alle Belange der Ehefrau und der Familie bestimmen. In der Kindererziehung mussten gemeinsame Entscheidungen getroffen werden.
Zwar blieb die Bundesrepublik anfangs eine patriarchalische Gesellschaft. Aber dank ihres Grundgesetzes hatte sie den Auftrag, sich zu wandeln und zu emanzipieren. Das Bundesverfassungsgericht sorgte auch in der Folgezeit in mehreren Urteilen für mehr Gleichberechtigung, sei es im Familien- oder im Scheidungsrecht. Die Klägerinnen sowie die Gerichte beriefen sich immer wieder auf jenen Passus, den die Republik Elisabeth Selbert zu verdanken hat.
Hits: 11